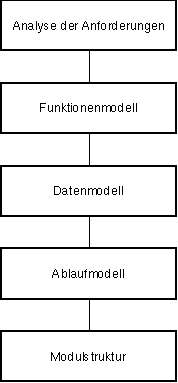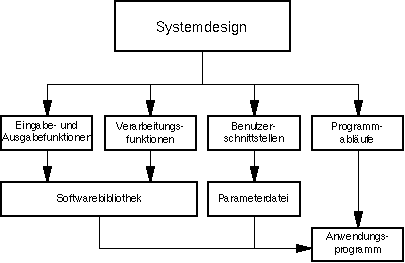|
|
 |
 |
Die Softwareentwicklung erstellt nach
folgendem Prozessmodell aus den Anforderungen und dem fachlichen
Grobkonzept einen Systementwurf, der als Grundlage für die Entwicklung
dient:
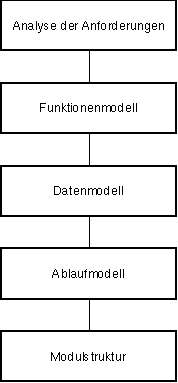
Der klassische Vorgang der ingenieurmäßigen Softwareentwicklung
sieht vor, dass die Software entsprechend den detailliert vorliegenden
Anforderungen des Auftraggebers ähnlich hergestellt wird, wie ein
Tischler nach den ihm übergebenen Plänen millimetergenau Möbel
produziert. Leider kommt diese Situation meist nur in Lehrbüchern und
in der Vorstellungswelt von Softwareentwicklungstheoretikern vor.
Die Designarbeit bei der Dialog Data hat entscheidenden Einfluss
sowohl auf die weitere Vorgangsweise bei der Entwicklung wie noch viel
mehr auf die Einsatzmöglichkeiten, die später dem Anwender geboten
werden. Sie ist durch etliche Besonderheiten gekennzeichnet:
-
Viele Anwender haben Schwierigkeiten, ihre
Anforderungen konkret in einer für die Softwareentwicklung
geeigneten Form festzulegen. Ein Fleischhauer will sich um den
Inhalt seiner Wurst kümmern und nicht um die Gestaltung von
Computerprogrammen für die Buchhaltung.
-
Die Dialog Data entwickelt kaum Individualsoftware,
sondern bietet fertige Lösungen in Anwendungsbereichen, in denen
ein umfassendes fachliches Know How vorhanden ist. Individuelle
Programme werden nur als Ergänzungen zu diesen Lösungen
entwickelt.
-
Die Anwendungssysteme unterliegen einem permanenten
Entwicklungsprozess, werden ständig an die technische Entwicklung
und an geänderte Voraussetzungen angepasst sowie um zusätzliche
Funktionen erweitert. Deshalb kann die Entwicklungsarbeit an einem
System niemals als abgeschlossen angesehen werden.
-
Die Software der Dialog Data zeichnet sich durch
einen extrem hohen Wiederverwendungsanteil aus. Eine zentrale
Aufgabe des Softwaredesigns besteht somit darin, in den
Anforderungen alle Aufgaben zu identifizieren, die bereits einmal
gelöst wurden und daher nicht nochmals entwickelt werden dürfen.
-
Ein zweiter Aspekt der Wiederverwendung betrifft das
Design aller neu zu entwickelnden Funktionen. Hier müssen alle
Module so gestaltet werden, dass eine spätere Wiederverwendung
problemlos möglich ist, wobei speziell alle bekannten Anforderungen
zur betrachteten Aufgabenstellung zu berücksichtigen sind, auch
wenn diese im Grobkonzept, auf dem der aktuelle Entwicklungsauftrag
basiert, nicht vorgesehen sind.
Das Design darf sich aus diesen Gründen nicht auf den vorliegenden
Entwicklungsauftrag beschränken, sondern muss die Aufgabe in jedem Fall
aus einer globaleren Sicht sehen, um künftige Entwicklungen nicht
unnötig einzuschränken. Neben der Wiederverwendung sind Wartbarkeit
und Erweiterbarkeit wesentliche Aspekte, die beim Design zu
berücksichtigen sind.
|
Das Funktionenmodell |
| Das Funktionenmodell konkretisiert im Zuge der
Analyse der Anforderungen die teilweise schon im Grobentwurf
festgelegten Prozesse, Aufgaben und Methoden nach fachlichen
Gesichtspunkten.
Hier werden die Schnittstellen zur Umgebung und der zugehörige
Transfer von eingehenden und ausgehenden Daten definiert.
Gleichzeitig wird das System strukturiert und die
Anwendungsarchitektur festgelegt.
Dabei orientiert sich der Designprozess an der für Software
allgemein gültigen Hierarchie:
-
Ein Anwendungssystem (etwa ein
Warenwirtschaftssystem) wird bei entsprechendem Umfang nach
fachlichen und systemtechnischen Gesichtspunkten in möglichst
unabhängige Teilsysteme (Inventur, Bestellwesen,
Lagerverwaltung und andere) gegliedert.
-
Das Anwendungssystem oder die Subsysteme
werden in einzelne Anwendungsprogramme zerlegt, wobei
darauf zu achten ist, dass zwischen den einzelnen Programmen
möglichst wenig Abhängigkeiten bestehen.
-
Alle von einem Programm zu bewältigenden
Teilaufgaben werden als Prozeduren oder Funktionen
definiert, wobei Funktionen mit verwandter Aufgabenstellung zu
Modulen zusammengefasst werden.
Diese Strukturierung entspricht den zuvor dargestellten Ebenen
der Softwareentwicklung und liefert eine Gliederung der
Entwicklungsaufgaben nach unterschiedlichen Anforderungen an die
fachliche Qualifikation der Entwickler. |
|
Datenmodellierung |
| Das Datenmodell legt die Objekte und die
zugehörigen Informationen fest sowie die Form, in welcher diese
Informationen dauerhaft gespeichert werden.
Aus der Konzeption der Anwendungsarchitektur ergibt sich die
grundlegende Datenorganisation, die in allen Anwendungen der
Dialog Data strikt eingehalten wird:
-
Die Stammdaten enthalten über längere
Zeit gleichbleibende Informationen und stehen völlig unter
Kontrolle des Anwenders.
-
Die Bewegungsdaten enthalten
Transaktionen, die ebenfalls nur von Anwender verändert
werden.
-
Die Bestandsdaten umfassen jene Daten,
die das System aus den Stammdaten und Bewegungsdaten erzeugt
hat, zum Beispiel die Salden je Buchhaltungskonto. Diese Daten
stehen unter Kontrolle der Software, der Anwender hat unter
normalen Umständen keine Möglichkeit eine Veränderung. Er
kann lediglich die Ausgangsdaten (Stammdaten oder
Bewegungsdaten) modifizieren und die Verarbeitung wiederholen,
mit welcher die Bestandsdaten erzeugt werden.
Hier wird die Zuständigkeit für die Datenbestände eindeutig
geregelt und systemweit beachtet: Der Benutzer verwaltet
Stammdaten und Bewegungsdaten, während das System die
Bestandsdaten kontrolliert, was nicht zuletzt auch eine klarere
Abgrenzung der Quelle für eventuelle Fehler erlaubt. |
|
Das Ablaufmodell |
| Das Ablaufmodell beschreibt einerseits die vom
System bewältigten Prozesse und organisatorischen Zusammenhänge
und legt andererseits die Schnittstellen zum Benutzer fest.
Gleichzeitig erfolgt eine Gliederung nach den Bearbeitungsformen
der Datenbestände, wobei folgende Formen unterschieden
werden:
-
Mit Erfassungsprogrammen für
Stammdaten und Bewegungsdaten gibt der Anwender die
benötigten Informationen in das System ein. Er kann sich
darauf verlassen, dass das System die von ihm erfassten Daten
in keiner Weise verändert.
-
Die Verarbeitungsprogramme erzeugen aus
den erfassten Daten neue Informationen, die als Bestandsdaten
bezeichnet werden. Sofern nicht gesetzliche Vorschriften
dagegen sprechen, müssen diese Verarbeitungen so gestaltet
sein, dass sie jederzeit wiederholt werden können und aus den
Eingangsdaten - sofern diese nicht mittlerweile verändert
wurden - dieselben Bestände erzeugen wie bei allen
vorangegangenen Ausführungen. In speziellen Fällen können
diese Verarbeitungen in die Erfassungsprogramme integriert
sein.
-
Schließlich liefern Auswertungsprogramme Informationen
aus den vorhandenen Stammdaten, Bewegungsdaten und
Bestandsdaten. Diese Programme zeichnen sich dadurch aus, dass
sie unter keinen Umständen die gespeicherten Daten verändern
und vom Anwender beliebig oft ausgeführt werden können.
-
Daneben werden in manchen Anwendungen
Programme zur Reorganisation der Datenbestände
benötigt, die jedoch hinsichtlich ihrer Funktionalität zu
den Erfassungsprogrammen zählen und nur dazu dienen,
Datenmanipulationen auszuführen, die der Anwender sonst
händisch erledigen müsste, etwa wenn aus einer
Adressenkartei alle Kunden gelöscht werden sollen, die seit
mehr als fünf Jahren nichts gekauft haben.
Diese Abgrenzung ermöglicht unter anderem eine Klassifizierung
der Programme nach ihrem Gefahrenpotential und eine entsprechende
Anpassung des Entwicklungsprozesses und der Testprozeduren. Die
Auswertungsprogramme haben beispielsweise nur lesenden Zugriff auf
die Dateien, verändern keinerlei Datenbestände und können damit
keine Fehler enthalten, die zu Folgeschäden im System führen.
Andererseits stellen Verarbeitungsprogramme und
Reorganisationsfunktionen in der Regel keine besonderen
Anforderungen an die Benutzerschnittstellen, sind jedoch
hinsichtlich der Konsistenz der Datenbestände besonders kritisch. |
|
Modulstruktur |
| Das Ergebnis der einzelnen Designphasen ist ein
Modularisierungskonzept, das als Grundlage für die weitere
Entwicklung dient.
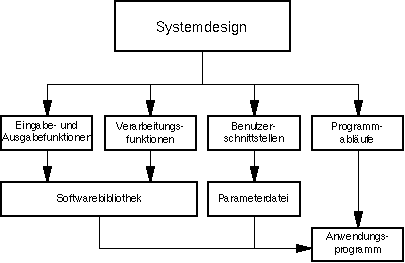
Dazu wird der Softwareentwurf unter
Berücksichtigung der obigen Grundsätze nach vier Gesichtspunkten
gegliedert:
-
Die Modellierung des Datensystems
analysiert die von der Software bearbeiteten Daten, speziell
jene, die auf externen Massenspeichern abgelegt werden, fasst
sie zu sinnvollen Einheiten zusammen und erstellt für jede
Einheit einen Entwicklungsauftrag an die Modulentwicklung.
Kein Programm darf auf externe Datenbestände direkt
zugreifen, sondern muss für die Zugriffsoperationen
ausschließlich die dafür vorgesehenen Modulfunktionen
verwenden. Die physische Speicherung der Daten bleibt den
Anwendungsprogrammen damit vollständig verborgen und kann
jederzeit gegen ein anderes Modell ausgetauscht werden.
-
Bei der Analyse der Funktionen wird die
Aufgabenstellung so weit in Teilaufgaben zerlegt, dass jede
Teilaufgabe nur noch eine spezielle Funktion zu erfüllen hat.
Für jede dieser Funktionen wird geprüft, ob in den
Softwarebibliotheken bereits eine Lösung dazu verfügbar ist,
was im Durchschnitt bei 80 % der benötigten Funktionen der
Fall ist, weshalb dieser Anteil der Software keine
Entwicklungsarbeit erfordert, sondern durch Wiederverwendung
gelöst wird. Für alle nicht verfügbaren Funktionen werden
wie bei Dateioperationen Entwicklungsaufträge an die
Modulentwicklung vergeben.
-
Die Gestaltung der Benutzerinterfaces
legt das Layout von Bildschirmmasken und Listen fest. Für
diese Benutzerinterfaces werden ausschließlich bereits
verfügbare Standardprozeduren verwendet, weshalb hier
lediglich Konfigurationsaufgaben zu bewältigen sind. Für
Benutzerinteraktionen gelten dieselben Grundsätze wie für
Dateizugriffe: Kein Anwendungsprogramm darf derartige
Operationen selbst ausführen, sondern muss dazu die
Standardfunktionen aus den entsprechenden Softwarebibliotheken
verwenden.
-
Die Analyse der Dynamik legt die
programminternen Abläufe und Interaktionen fest, wobei sich
die Struktur der eigentlichen Anwendungsprogramme ergibt.
Auch in dieser Gliederung zeigt sich das Grundkonzept der
Softwareentwicklung der Dialog Data: Drei Viertel der Aufgaben
(nämlich die ersten drei Punkte in der obigen Übersicht) werden
in standardisierter und wiederverwendbarer Form über
Bibliotheksfunktionen gelöst, während die Anwendungsprogramme
(Punkt 4) sich darauf beschränken, diese Funktionen in einer
sinnvollen Reihenfolge anzuwenden. |
|
Wiederverwendung |
| Die Wiederverwendung spielt in der
Softwareentwicklung der Dialog Data seit jeher eine zentrale
Rolle. Grundsätzlich dürfen Aufgaben, für die bereits an
anderer Stelle eine Lösung entwickelt wurde, nicht ein zweites
Mal in der Software programmiert werden. Alle Funktionen werden in
Softwarebibliotheken abgelegt und müssen von dort verwendet
werden.
Neben den nachstehend noch behandelten Vorteilen der
Wiederverwendung ergibt sich aus diesem Konzept eine wesentlich
höhere Produktivität der Softwareentwicklung, da ein
neues Programm im Durchschnitt zu 80 % aus wiederverwendeten
Funktionen besteht. Auch die Softwarewartung profitiert ganz
wesentlich davon, da Anpassungen der Funktionalität nur beim
jeweiligen Modul vorgenommen werden müssen und danach automatisch
in der gesamten Software verwendet werden.
Dem Benutzer zeigt die Software auch über mehrere
Anwendungssysteme hinweg ein einheitliches Verhalten. Die
Funktionalität ist dem Anwender oft schon aus anderen Anwendungen
bekannt, was den Einarbeitungsaufwand ebenso wie die
Möglichkeiten zur Fehlbedienung reduziert. |
|
Fehlervermeidung
durch Design |
| Ein grundlegendes Ziel der Qualitätssicherung ist
die frühzeitige Erkennung von Fehlern. Wesentlich besser ist es
jedoch, das Entstehen von Fehlern möglichst weitgehend gar nicht
erst zu ermöglichen.
Der Designprozess sichert nicht nur die qualitativen
Eigenschaften der Software, sondern beinhaltet durch entsprechende
Konzeption und Gliederung der Programme, Module und Funktionen
wesentliche Voraussetzungen für eine umfassende Fehlervermeidung:
Zunächst werden Fehlerquellen durch das strikte
Wiederverwendungskonzept reduziert: Wenn Softwareteile nicht neu
entwickelt werden müssen, können dabei auch keine neuen Fehler
auftreten. Bei einem Wiederverwendungsanteil von 80 % werden
bereits auf diese Weise vier Fünftel aller möglichen Fehler
ausgeschlossen. Die wiederverwendeten Funktionen haben neben
etlichen weiteren den Vorteil, dass sie bereits in der Praxis
eingesetzt werden, extrem gut getestet sind und wegen der
permanenten Verbesserungsmaßnahmen die Anforderungen des
konkreten Entwicklungsauftrags in den meisten Fällen von
vornherein übertreffen.
Da die Softwareentwicklung der Dialog Data für praktisch alle
in kommerziellen Anwendungen benötigten Standardaufgaben bereits
vorgefertigte, wiederverwendbare und sehr robuste Funktionen in
Softwarebibliotheken verfügt, können bereits auf diesem Weg
zahlreiche Fehlerquellen eliminiert werden. Gerade die kritischen
und fehleranfälligen Routinen mit komplexer Aufgabenstellung sind
längst entwickelt, extrem gut getestet und haben sich in der
Praxis vielfach bewährt.
Insgesamt stehen derzeit etwa 9.000 wiederverwendbare
Funktionen zur Verfügung, was in einer weiteren Hinsicht zu einer
Verringerung der Fehlerquellen führt: Die Programmierung kann
sich auf die wirklich neuen Verarbeitungen konzentrieren und sich
bei vielen Teilaufgaben auf Funktionsaufrufe beschränken, was zu
entsprechend handlichen Routinen und Programmen führt. Das
Ergebnis dieser Bemühungen ist an der derzeit verfügbaren
Software erkennbar: Die durchschnittliche Länge einer Sourcedatei
beträgt 133 Textzeilen, es gibt insgesamt nur drei Module mit
mehr als 1000 Zeilen, wobei der größte eine Länge von 1500
Zeilen hat. Die durchschnittliche Länge einer Funktion beträgt
überhaupt nur 25 Zeilen.
Damit ist jede Funktion auf die absolut notwendige Komplexität
reduziert, hat einen mit freiem Auge überschaubaren Umfang und
kann mit 100 % Abdeckung getestet werden. Die Fehlerfreiheit jeder
einzelnen Funktion ist daher mit beinahe absoluter Sicherheit
gegeben, was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass ein Programm
der Dialog Data niemals abstürzt.
Als Nebeneffekt dieser Konzeption hat jeder Programmierer die
Möglichkeit, mit einfachsten Mitteln unter Verwendung der
verfügbaren Bausteine hochintelligente und komplexe
Verarbeitungen zu entwickeln, ohne große Folgeprobleme
befürchten zu müssen. Das ist nicht zuletzt auch eine
Voraussetzung dafür, dass Firmen mit eigener Softwareentwicklung
die Bibliotheken der Dialog Data auch für Eigenentwicklungen
verwenden.
Ein weiterer Aspekt der Fehlervermeidung durch Modularisierung
und Wiederverwendung besteht in der drastischen Reduzierung der
Fehlergefahr bei Programmänderungen: Falls die Arbeitsweise einer
Funktion anzupassen ist oder die Funktionalität erweitert werden
soll, muss nur ein klar abgegrenzter Modul verändert werden.
Zusätzlich haben derartige Änderungen globale Auswirkungen:
Nach der Neukompilation enthalten alle Programme - oft über
mehrere Anwendungssysteme hinweg - die neue Funktionalität, ohne
dass bei der Änderung des Moduls überhaupt bekannt ist, in
welchen Programmen die betreffende Funktion tatsächlich verwendet
wird. Durch Änderung einer einzelnen Funktion können 30 oder 50
Programme verbessert werden, ohne dass die Programmentwicklung die
Sourcedateien dieser Programme auch nur betrachtet, was die
Fehlergefahr eminent vermindert.
Durch die Modularisierung und die damit zusammenhängende
detaillierte Konzeption aller Funktionen werden nicht nur
Designfehler und Inkonsistenzen frühzeitig erkannt, der weitere
Entwicklungsablauf ist vielmehr in so kleine Einheiten gegliedert,
dass er weitgehend automatisiert und in Eigenverantwortung durch
den Entwickler erledigt werden kann (siehe Entwicklungsprozess im
nächsten Abschnitt). |
|
Prototyping |
| Beim Design dienen Prototypen dazu, die
Möglichkeiten zur Gestaltung von Interfaces oder von Abläufen zu
prüfen. Mit entsprechenden Tools ist mit wenig Aufwand zumindest
die Erstellung von Masken und groben Strukturen möglich, welche
als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen dienen
können. Es werden auch die Gespräche mit den Anwendern
vereinfacht, wenn statt verbaler Beschreibungen konkrete
"Anwendungen" verfügbar sind. Auch der Aufwand für das
Detailkonzept oder das Pflichtenheft reduziert sich, wenn man
statt der Beschreibung zahlloser einzelner Eingabefelder auf die
Maske in einem bereits vorhandenen Prototypen verweisen kann.
In der Entwicklung sind für bestimmte, immer wieder
benötigte Verarbeitungsformen Prototypen vorhanden, die für eine
konkrete Aufgabe nur noch entsprechend adaptiert werden müssen.
Beispielsweise arbeitet die Erfassung für die meisten Stammdaten
nach demselben Muster. Zur Entwicklung eines neuen
Erfassungsprogramms müssen im Prototyp nur noch die benötigten
Datenfeldoperationen eingebaut und die Zugriffe auf den
entsprechenden Dateiverwaltungsmodul eingebaut sowie die
Benutzerinterfaces konfiguriert werden.
Schließlich werden Prototypen beim Test der Software
verwendet, wenn von einem System erst einzelne Module
fertiggestellt sind. Ein Datenzugriffsmodul kann nicht getestet
werden, wenn die entsprechenden Erfassungsfunktionen noch nicht
entwickelt sind. In solchen Fällen werden die fehlenden
Systembestandteile durch Prototypen ersetzt, welche unter
Verwendung derselben Schnittstellen verwenden wie die geplanten
Module deren Funktionalität simulieren. |
 |
 |
Das Unternehmen |
|
 |
Qualitätswesen |
|
| Modulentwicklung |
 |
| Sicherung der
Dienstleistungsqualität |
 |
|
|
 |